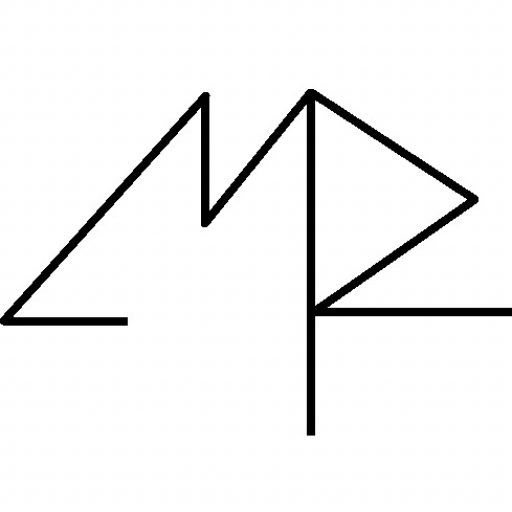Calcolosi urinaria / Nieren- und Harnleitersteine
La colica renale e i trattamenti mini-invasivi della calcolosi
Reduci dai caldi estivi si assiste sempre più all’insorgenza di coliche renali dovute a calcolosi urinaria.
La prevalenza di questa patologia è infatti sempre più in aumento con percentuali stimate intorno al 15 % della popolazione.
Il sesso maschile risultata statisticamente più interessato, nonostante vi sia un sempre maggiore aumento di incidenza nella popolazione femminile.
L’alimentazione riveste sicuramente il ruolo di uno dei responsabili dell’incidenza calcolosi urinaria, vanno però considerati anche lo stile di vita, la sedentarietà, le infezioni delle vie urinarie, le alterazioni anatomiche, eventuali patologie associate e fattori genetici.
Nel periodo che segue ai forti caldi dei mesi estivi si assiste da un incremento degli accessi alle strutture sanitarie per la comparsa di improvvisi e intensi dolori lombari, in gran parte riconducibili a colica renale. A questo punto sorge spontaneo chiedersi cosa sia la colica renale, da cosa dipenda e come risolverla.
DOMANDE FREQUENTI
Qual è il primo sintomo che si avverte quando si ha una colica renale?
Senza dubbio il dolore al fianco. Dolore che insorge per lo più improvvisamente, con intensità piuttosto forte ed irradiato alla regione inguinale. Ad eccezione del dolore da parto e si dice che il dolore da colica renale sia uno dei più forti che si possano provare nella vita. Talvolta il sintomo è accompagnato da nausea, sudorazione e vomito e non vi sono particolari posizioni che lo possano alleviare.
Al di là del dolore, la colica può provocare danni all’organismo?
La colica è dovuta ad una sovradistensione della via urinaria, legata ad un ostacolo al deflusso dell’urina prodotta dal rene. Nella maggior parte dei casi l’ostacolo è rappresentato da un calcolo. I calcoli, aggregati a componente solitamente mista, vengono rilasciati a livello renale e non danno segno della loro presenza se di piccole dimensioni e localizzati a livello renale, poiché giacciono in una cavità piuttosto ampia. Quando questi calcoli finiscono nel condotto di comunicazione fra rene e vescica, chiamato uretere, possono provocare un’ostruzione, generando la colica. Il dolore può associarsi a dilatazione più o meno significativa della via urinaria a monte del calcolo, provocare eventuale danno renale e generare eventi settici, assolutamente da non trascurare o sottovalutare. Va precisato che la colica renale, in percentuali minori dei casi, può essere dovuta ad altre cause, ne sono un esempio coaguli, neoplasie, compressioni dell’uretere da strutture esterne ad esso, ma qui esuliamo dal tema in questione.
Quanto conta bere e scegliere la giusta dieta nella prevenzione della calcolosi?
Sicuramente tanto. Soprattutto nei mesi estivi è fondamentale una ricca idratazione, senza particolari distinzioni fra le varie etichette di acqua, bisogna bere! In merito alla dieta si apre un capitolo più complesso da valutare in ambito medico specialistico. Per fare un esempio, contrariamente a quanto si possa pensare, ridurre degli apporti di calcio, non abbassa la produzione di calcolosi calcica. Importante è analizzare i calcoli laddove possibile ed eseguire in alcuni casi uno studio metabolico.
Come possiamo avere conferma che si tratta di un calcolo?
La descrizione dei sintomi e la visita dell’urologo forniscono indizi iniziali su che percorso diagnostico intraprendere. La colica renale va comunque studiata tramite un’ecografia iniziale per valutare un’eventuale quadro di dilatazione della via urinaria, seguita da una TC Addome (se eseguita con Mezzo di Contrasto ci fornisce informazioni aggiuntive su ostruzioni di natura diversa dalla calcolosi), accompagnata da esami del sangue ed urine per valutare la funzionalità renale e gli indici di infiammazione.
Bisogna sempre ricorrere ad intervento chirurgico per risolvere il problema?
No, nel caso in cui siamo di fronte a calcoli di piccole dimensioni, che hanno già percorso gran parte dell’uretere spontaneamente e se il paziente non presenta febbre ne sospetti di infezione, é consigliato stimolare l’espulsione del calcolo servendosi di apposite terapie ed idratazione. Nei quadri di calcolosi di grosse dimensioni o in presenza di pazienti febbrili/settici o di sospette lesioni renali è indicato il drenaggio del rene per metterlo in sicurezza e monitorare il paziente, riservando il trattamento del calcolo ad un successivo momento.
Quali trattamenti quindi per eliminare i calcoli?
Al giorno d’oggi ci si avvale di tecniche sempre meno invasive. Basti pensare che fino a qualche decennio fa si procedeva quasi sempre con approccio chirurgico “a cielo aperto”. Attualmente si dispone di strumentari miniaturizzati che ci consentono una visualizzazione ad alta definizione e di lavorare dentro l’uretere e il rene polverizzando o frantumando i calcoli con l’energia Laser. Stiamo parlando degli interventi chirurgici di URS (Uretero-Reno-Scopia) e RIRS (Retrograde Intra-Renal Surgery), quest’ultimo si serve di uno strumento flessibile che percorre l’intero asse escretore endoscopicamente (tutto per vie naturali) sino a giungere nel rene. Con l’ausilio di una visione in alta definizione e dell’energia laser, si procede alla polverizzazione/frantumazione dei calcoli renali. Tali interventi vengono solitamente eseguiti con una notte di degenza. Esistono poi altri trattamenti come la litotrissia extracorporea (EWSL) o interventi a maggior invasività come la litotrissia percutanea (PNL), più efficiente in quadri di calcolosi non affrontabili endoscopicamente (per vie naturali) o interventi di chirurgia maggiore ormai riservati ad una minima percentuali di casi selezionati.
E’ fondamentale valutare ogni caso singolarmente al fine di porre indicazione al giusto tipo di trattamento.
Nierenkoliken und minimalinvasive Behandlungen von Nierensteinen
Nach den heißen Sommermonaten treten vermehrt Nierenkoliken aufgrund von Harnsteinen auf.Die Prävalenz dieser Erkrankung nimmt stetig zu und liegt schätzungsweise bei etwa 15 % der Bevölkerung.Statistisch gesehen sind Männer häufiger betroffen, auch wenn die Zahl bei Frauen zunimmt.Die Ernährung spielt sicherlich eine Rolle bei der Entstehung von Harnsteinen, aber auch Lebensstil, Bewegungsmangel, Harnwegsinfekte, anatomische Veränderungen, Begleiterkrankungen und genetische Faktoren müssen berücksichtigt werden.In der Zeit nach der intensiven Hitze der Sommermonate verzeichnen wir einen Anstieg der Arztbesuche aufgrund plötzlich auftretender und starker Schmerzen im unteren Rücken, die größtenteils auf Nierenkoliken zurückzuführen sind. An diesem Punkt stellt sich natürlich die Frage: Was ist eine Nierenkolik, was verursacht sie und wie kann sie behandelt werden.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Was ist das erste Symptom einer Nierenkolik?
Zweifellos sind es Flankenschmerzen. Diese Schmerzen treten meist plötzlich auf, sind sehr stark und strahlen in die Leiste aus. Abgesehen von Geburtsschmerzen gehören Nierenkoliken zu den stärksten Schmerzen, die man im Leben erleben kann. Manchmal gehen sie mit Übelkeit, Schwitzen und Erbrechen einher, und keine bestimmte Position kann sie lindern.
Können Koliken neben den Schmerzen auch Schäden verursachen?
Koliken entstehen durch eine Überdehnung der Harnwege, die mit einer Behinderung des Harnflusses durch die Niere einhergeht. In den meisten Fällen handelt es sich bei der Behinderung um einen Stein. Steine, die meist aus gemischten Bestandteilen bestehen, werden von der Niere ausgeschieden und sind, wenn sie klein und auf die Niere beschränkt sind, nicht erkennbar, da sie in einem größeren Hohlraum liegen. Gelangen diese Steine in den Harnleiter, den Verbindungskanal zwischen Niere und Blase, können sie eine Verstopfung verursachen und so Koliken auslösen. Schmerzen können mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Erweiterung der Harnwege oberhalb des Steins einhergehen und möglicherweise Nierenschäden und septische Ereignisse verursachen, die nicht ignoriert oder unterschätzt werden sollten. Es ist zu beachten, dass Nierenkoliken in einem geringeren Prozentsatz auch andere Ursachen haben können, wie z. B. Blutgerinnsel, Tumore oder eine Kompression des Harnleiters durch äußere Strukturen. Dies würde jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen.
Wie und die richtige Ernährung zur Vorbeugung von Nierensteinen?
Auf jeden Fall. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist unerlässlich, insbesondere in den Sommermonaten. Unabhängig von der Bezeichnung: Trinken ist wichtig! Die Ernährung ist ein komplexeres Thema, das von einem Facharzt beurteilt werden muss. Entgegen der landläufigen Meinung reduziert beispielsweise eine reduzierte Kalziumzufuhr nicht die Bildung von Kalziumsteinen. Es ist wichtig, die Steine nach Möglichkeit zu analysieren und gegebenenfalls eine Stoffwechseluntersuchung durchzuführen.
Wie lässt sich feststellen, ob es sich um einen Stein handelt?
Die Beschreibung der Symptome und die Untersuchung durch den Urologen geben erste Hinweise für die Diagnose. Nierenkoliken sollten zunächst mit einer Ultraschalluntersuchung auf Anzeichen einer Harnwegserweiterung untersucht werden. Anschließend sollte eine CT des Abdomens durchgeführt werden (bei Kontrastmittelgabe liefert sie zusätzliche Informationen über andere Obstruktionen als Steine). Blut- und Urinuntersuchungen dienen der Beurteilung der Nierenfunktion und von Entzündungsindikatoren.
Ist eine Operation immer notwendig, um das Problem zu beheben?
Nein. Bei kleinen Steinen, die den Harnleiter bereits größtenteils spontan passiert haben und der Patient weder Fieber noch einen Infektionsverdacht hat, wird empfohlen, den Steinabgang durch geeignete Therapien und Flüssigkeitszufuhr zu fördern. Bei großen Steinen, fiebrigen/septischen Patienten oder Verdacht auf Nierenschäden ist eine Nierendrainage zur Sicherheit und Überwachung des Patienten angezeigt. Die Behandlung der Steine sollte zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es also zur Entfernung von Steinen?
Heutzutage werden zunehmend weniger invasive Techniken eingesetzt. Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde fast ausschließlich eine offene Operation durchgeführt. Heutzutage ermöglichen miniaturisierte Instrumente eine hochauflösende Visualisierung und das Arbeiten im Harnleiter und in der Niere, um Steine mit Laserenergie zu zerkleinern oder zu zertrümmern. Dazu gehören die Uretero-Rhinoskopie (URS) und die Retrograde Intrarenale Chirurgie (RIRS). Bei letzterer wird ein flexibles Instrument endoskopisch (durch natürliche Kanäle) entlang der gesamten Ausscheidungsachse bis zur Niere geführt. Mittels hochauflösender Bildgebung und Laserenergie werden Nierensteine zerkleinert bzw. zertrümmert. Diese Eingriffe erfordern in der Regel eine Krankenhausübernachtung. Weitere Behandlungen sind die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (EWSL) oder invasivere Verfahren wie die perkutane Stoßwellenlithotripsie (PNL), die bei Steinen, die nicht endoskopisch (natürlich) behandelt werden können, wirksamer ist, sowie größere chirurgische Eingriffe, die derzeit nur in wenigen Fällen durchgeführt werden.
Es ist wichtig, jeden Fall individuell zu beurteilen, um die geeignete Behandlung zu bestimmen.
Posted on: Agosto 20, 2023, by : matteo